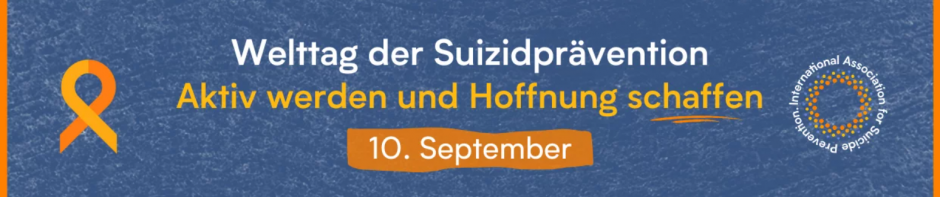Jedes Jahr nehmen sich in Deutschland ungefähr 10.000 Menschen das Leben,
davon sind ungefähr 70% Männer. Dass Suizidrisiko steigt bei Frauen und Männern mit dem Lebensalter. Das Durchschnittliche Lebensalter eines durch Suizid Verstorbenen liegt bei ca. 58 Jahren – mit steigender Tendenz. In Deutschland sterben ungefähr genau so viel Menschen durch Suizid wie durch Verkehrsunfälle, AIDS, illegale Drogen und Gewalttaten zusammen.
Die Anzahl der Suizidversuche kann auf mindestens 100.000 im Jahr geschätzt werden.
Suizidversuche werden besonders häufig von Frauen und in jüngerem Lebensalter unternommen. Suizidversuche können oft als „Hilferufe“ interpretiert werden. Sie müssen immer ernst genommen werden, da sie einen Hinweis auf das Vorhandensein ernstzunehmender psychischer Probleme sind. Ungefähr jeder Dritte unternimmt nach dem ersten einen weiteren Suizidversuch und jeder Zehnte stirbt später durch Suizid. Eine Unterscheidung zwischen „ernsthaften“ und „nicht ernsthaften“ Suizidversuchen wird in der Suizidforschung mehrheitlich nicht mehr getroffen.
Das Suizidrisiko ist bei allen psychischen Erkrankungen erhöht.
Dazu gehören besonders Psychosen, Suchterkrankungen, Persönlichkeitsstörungen und Depressionen. Der Anteil psychiatrischer Erkrankungen an Suiziden ist methodisch nur sehr schwierig zu erheben. Die vorliegenden Studienergebnisse unterscheiden sich erheblich: je nach Studie wurden 15% bis 95% der durch Suizid Verstorbenen als depressiv beurteilt. Die Wahrscheinlichkeit durch einen Suizid zu sterben liegt bei 4% bei Patienten mit affektiven Störungen, 5% bei an Schizophrenie erkrankten Patienten, 7% bei alkoholabhängigen Patienten, 8% bei Patienten mit bipolaren Störungen (WHO 2014). Das Risiko erhöht sich deutlich, wenn mehrere dies Störungen bei einem Patienten vorliegen
Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass aus Suizidgedanken nicht zwangsläufig auf eine psychische Erkrankung zu schließen ist. Das Suizidrisiko ist darüber hinaus im Vergleich mit dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung erhöht bei: Männern, Menschen im höheren Lebensalter, Menschen mit gleichgeschlechtlicher sexueller Orientierung und jungen Frauen mit Migrationshintergrund. Traumatisch erlebte Ereignisse wie der Verlust wichtiger Bezugspersonen, schwerere Erkrankungen, Veränderungen von Lebensumständen, wie Verlust des Arbeitsplatzes oder Untersuchungshaft bzw. schon die Angst vor solchen Ereignissen können bei vulnerablen Menschen Suizidgedanken auslösen. Jedoch ist das Vorhandensein auch mehrerer Risikofaktoren kein Indikator für Suizidgefährdung und keiner dieser Faktoren erklärt einen Suizid alleine.
Suizidalität ist ein tabuisiertes Thema.
Betroffenen Menschen fällt es – nicht selten auch während der Behandlung einer Erkrankung wie einer Depression – schwer über ihre Suizidgedanken mit ihrem Arzt oder Therapeuten zu sprechen. Wir wissen aus Studien, das Menschen vor einem vollendeten Suizid viel häufiger als üblich einen Arzt aufgesucht haben, die Suizidgefährdung aber nicht erkannt wurde. Häufig besteht die Angst darin, nicht ernst genommen zu werden, soziale Kontakte zu verlieren, als psychisch krank bezeichnet zu werden und vor Autonomieverlust durch zwangsweise Behandlung. Außerdem haben nicht wenige die Vorstellung, dass sie niemand verstehen und niemand ihnen helfen kann. Diese Ängste und Vorstellungen ergeben sich aus der psychischen Befindlichkeit der Betroffenen.
Suizidprävention ist möglich.
Suizidalität ist ein komplexes Phänomen und Suizidprävention deshalb auch eine vielschichtige Aufgabe. Das Nationale Suizidpräventionsprogramm begreift deshalb Suizidprävention als eine gesellschaftliche Aufgabe, die weit über den Bereich der Gesundheitspolitik hinausgeht. Eines der wirksamsten Mittel ist – soweit überhaupt möglich – die Einschränkung der Verfügbarkeit von Suizidmethoden (z.B. Waffen, Medikamente, Chemikalien, Absicherung von Bauwerken). Weitere Mittel der Suizdprävention sind u.a. die Verfügbarkeit niedrigschwelliger Behandlungsangebote, die Fortbildung in den medizinischen und psychosozialen Berufen sowie die Förderung die Früherkennung von Suizidgefährdung und von psychischen Erkrankungen und nicht zuletzt ein gesellschaftliches Klima, in welcher die Suizidproblematik wahr- und ernst genommen wird.
Suizidgefährdung ist behandelbar wenn der oder die Betroffene sich auf eine Behandlung einlässt.
Nicht selten ist allerdings eine große Herausforderung, Suizidgefährdete davon zu überzeugen, dass sie professionelle Hilfe benötigen. Je nach Problemlage und in Übereinkunft mit den Betroffenen kann die Behandlung ein breites ambulantes (und manchmal auch stationäres) Behandlungsangebot umfassen. Auch bei Vorliegen einer psychiatrischen Erkrankung und einer pharmakologischen Behandlung wird bei Suizidgefährdung immer das Angebot psychotherapeutischer Gespräche als bedeutsam angesehen.
Eine besondere Rolle spielen Medien in der Suizidprävention.
Aus vielen Untersuchungen ist bekannt, dass die mediale Darstellung von Suiziden weitere Suizide zur Folge haben kann. Dies gilt besonders auch für die Verbreitung von –evtl. bisher weitgehend unbekannten oder „exotischen“ Suizidmethoden. In den Tagen nach dem Suizid von Robert Enke hat es einen deutlichen Anstieg von Suiziden nach dem gleichen Muster gegeben, nach unserer Kenntnis auch noch einmal nach der Gedenkfeier. Das bedeutet nicht, dass über Suizide und die Suizidproblematik nicht berichtet werden sollte. Entscheidend ist die Art der Berichterstattung. Informationen dazu finden Sie im Medienportal des Nationalen Suizidpräventionsprogramms.
Ein Suizid betrifft viele Menschen.
Von jedem Suizid sind nach Schätzungen der WHO durchschnittlich deutlich mehr als sechs Personen betroffen. Nicht nur Angehörige, auch Freunde, Kollegen, Mitschüler etc. können in einem Maße betroffen sein, dass sie auch selbst Unterstützung benötigen. Der Trauerprozess nach einem Suizid kann erschwert sein und mehrere Jahre dauern. Für Hinterbliebene ist es wichtig, dass über Suizide offen gesprochen werden kann, ohne dass sie befürchten müssen, ausgegrenzt zu werden. Nicht vergessen werden dürfen auch die Folgen für weitere nahestehende Menschen (z.B. Arbeitskollegen, Mitschüler), in Ausübung ihres Berufes mit Suiziden konfrontierte Menschen (z.B. Ärzte, Therapeuten, Angehörige von Pflegeberufen, Polizisten, Feuerwehrangehörige u.v.a.m.) sowie Zeugen suizidaler Handlungen.
Literatur
Bursztein Lipsicas C, Mäkinen IH, Apter A, De Leo D, Kerkhof A, Lönnqvist J, Michel K, Salander Renberg E, Sayil I, Schmidtke A, van Heeringen K., Värnik A., Wasserman D. 2012. Attempted suicide among immigrants in European countries: an international perspective. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 47, 241 – 251.
Fiedler, G. (2012). Suizide in Deutschland 2011, Internet-Dokument: http://suizidpraevention.wordpress.com/suizide-in-deutschland-2011
Möller, H.J., Bürk, F., Dietzfelbinger, T., Kurz, A., Torhorst, A., Wächtler, C., Lauter, H. (1994) Ambulante Nachbetreuung von Patienten nach Suizidversuch. Empirische Untersuchung zur Verbesserung der Psychiatrischen Versorgung von Parasuizidpatienten im Allgemeinkrankenhaus. Regensburg: S. Roderer Verlag
Schaller, S. & Schmidtke, A. 2010. Suizidalität: epidemiologische Befunde, Probleme und Schlussfolgerungen für die Prävention. In: Stoppe, G. H. (Hrsg.) Die Versorgung psychisch kranker alter Menschen. Deutscher Ärzteverlag: Köln, 39 – 48.
Schmidtke, A., Sell, R. & Löhr, C. 2008. Epidemiologie von Suizidalität im Alter. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 41, 1 – 11.
Schmidtke, A., Bille-Brahe, U., DeLeo, D. & Kerkhof, A. (Hrsg.) (2002). Suicidal Behaviour in Europe: Results from the WHO/Euro Multicentre Study on Suicidal Behaviour. Göttingen: Hogrefe.
Schmidtke, A., Weinacker, B. & Fricke, S. (1998). Suizid. In: Statistisches Bundesamt (Hrsg.) Gesundheitsbericht für Deutschland, Kap. 5.16. Stuttgart: Metzler-Poeschel, 223 – 226.
Schmidtke, A., Weinacker, B. & Löhr, C. (2000). Epidemiologie der Suizidalität im 20. Jahrhundert. In: M. Wolfersdorf & C. Franke (Hrsg.) Suizidforschung und Suizidprävention am Ende des 20. Jahrhunderts. Regensburg: S. Roderer Verlag, 63 – 88.
Schneider, B. (2003): Risikofaktoren für Suizid. Regensburg: S. Roderer Verlag.
Statistische Bundesamt, Gesundheitsberichterstattung des Bundes: www.gbe-bund.de
Wasserman, D. (2002). Suicide Prevention in Europe. WHO Working Paper.